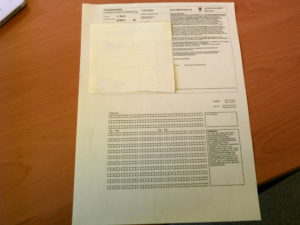Für Asylsuchende ist das „Yellow Paper“ ein enorm wichtiges Dokument. Ohne diese Bescheinigung erhalten sie keine freie medizinische Versorgung. Doch auch mit dem gelben Zettel in Händen gibt es oft noch Probleme, weiß Antje Sanogo, Asylsozialberaterin in München.
Ich arbeite seit Anfang 2016 in der Asylsozialberatung einer Übergangsunterkunft für Flüchtlinge der Stadt München. Da die Unterkunft gerade erst eröffnet wurde, sind wir ein ganz neues Team. Mit viel Enthusiasmus stürtzen wir uns die Arbeit, und diese besteht vor allem daraus, die medizinische Versorgung der Bewohner_innen zu organisieren.
Eine häufige Beschwerde sind Zahnschmerzen. Verständlicherweise ist die Sorge um die Zähne auf der Flucht ein eher unwichtiges Thema. Nach der Ankunft und ein paar Tagen Ruhe werden die Schmerzen allerdings irgendwann unerträglich, und dann beginnen die Probleme: kein „Yellow Paper“, also kein Behandlungsschein von der Sozialbehörde (in Bayern ist dieser aus gelbem Papier). Und ohne diesen Schein auch kein Besuch bei einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin. Zunächst glaubt man als erfolgsverwöhnte Beraterin noch: Ab in die Notfallambulanz – die müssen ja behandeln. Aber weit gefehlt: Ohne „Yellow Paper“ geht auch dort nichts.
Ein kranker Zahn will schnell behandelt werden
Ein Yellow Paper zu besorgen, ist nicht so einfach, wie man denkt. Ausgestellt wird der Behandlungsschein von einer Sozialbehörde, also derselben Behörde, die auch für die Auszahlung der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig ist. Die Geldleistungen müssen jeden Monat an jeden Flüchtling persönlich ausgezahlt werden. Das heißt, jeder Flüchtling muss mindestens einmal im Monat in der Behörde vorsprechen.
Daraus folgt, dass die Behörde immer überlaufen ist und die Sachbearbeiter_innen permanent unter Stress stehen. Zwar wird versucht, jedem Flüchtling zu Beginn eines Quartals zumindest einen Behandlungsschein für den Allgemeinarzt und die Zahnärztin mitzugeben. Aber meist kommt es anders: Lädierte Knie müssen zum Orthopäden, Nierensteine zur Nephrologin, Projektilreste zum_zur Chirurg_in, und so pflegen wir inzwischen ein sehr persönliches Verhältnis zu der für unsere Unterkunft zuständigen Sachbearbeiterin in der Sozialbehörde. Wir schreiben uns täglich E-Mails und telefonieren miteinander. Die Beschaffung eines Yellow Papers kann also schon einmal mehrere Tage dauern. Mit Zahnschmerzen ist das nicht angenehm.
Fehlende Sprachmittler_innen
Doch die Probleme in der medizinischen Versorgung sind mit dem Behandlungsschein noch lange nicht gelöst. Hat jemand das Yellow Paper erhalten, greift der_die geübte Berater_in zum Telefon und ruft eine entsprechende Arztpraxis an, um einen Termin zu vereinbaren. Sobald das erste Mal der Begriff „Asylbewerber“ oder „Flüchtling“ fällt, ist vom anderen Ende der Leitung schon eine gewisse Skepsis zu spüren.
Dann bekommt der Patient entweder einen Termin in vier bis sechs Wochen oder er erfährt, dass die Praxis keine Patient_innen mit Behandlungsschein vom Sozialamt nimmt. Für uns ist das auch eine Art interkulturelles Lernen. Inzwischen haben wir uns abgewöhnt, Termine zu vereinbaren. Wir schicken unsere Bewohner_innen einfach ohne Termin zu den Ärzt_innen – dann ist es weniger leicht, sie abzuwimmeln.
Ein weiteres riesiges Problem ist die sprachliche Verständigung. Es gibt einfach keine finanziellen Mittel, um bei jedem Arztbesuch einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin mitzuschicken. Natürlich finden es alle wichtig, dass Dolmetscher_innen verfügbar sind – aber wie gesagt: bezahlen will sie niemand. Wir haben als Sozialdienst pro Bewohner_in und Jahr 60 Euro für Dolmetscher-Dienste zur Verfügung. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als zu priorisieren.
So behelfen wir uns mit Bewohner_innen, die Englisch sprechen und bereit sind, ihre Landsleute zu Arztterminen zu begleiten. Das geht aber eigentlich nur bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Sobald es intimer wird, ist es schon schwieriger – sagen wir mal bei einer Analfissur. Im alltäglichen Kampf um die medizinische Versorgung kann ich den Satz „Ohne Dolmetscher können wir nicht behandeln“ nicht mehr hören. Irgendwann wünschen wir uns auf der anderen Seite endlich mal ein gewisses Maß an Flexibilität.
Überweisungsmarathon
Ein Bewohner mit einer schlecht verheilten Schussverletzung, in der sich noch Projektilreste befanden, wurde zehn Wochen lang von Arzt zu Ärztin, von Krankenhaus zu Ambulanz herumgereicht, bis sich endlich einmal jemand zu der Entscheidung durchringen konnte, dass die Projektilreste dann doch raus müssten, und schließlich eine Operation angesetzt wurde.
Diese Odyssee hatte übrigens nichts mit Finanzierungsfragen zu tun, denn das Sozialamt hatte sich von Anfang an bereit erklärt, die Operationskosten zu übernehmen. Es schien vielmehr so, als ob sich einfach niemand traute, die Verantwortung für die Behandlung und Operation zu übernehmen, weshalb der Patient dann lieber doch noch einmal zum nächsten Spezialisten geschickt wurde.
Ein Bewohner mit heftigen Knieschmerzen tourte wochenlang von Termin zu Termin, weil sich die Hausarztpraxis und die Radiologiepraxis nicht darüber einigen konnten, ob zusätzlich zum berühmten Yellow Paper noch ein Überweisungsschein ausgestellt werden muss. Das Problem ließ sich nicht abschließend klären. Die Radiologie lenkte irgendwann ein und untersuchte das Knie ohne Überweisungsschein.
Mehr Flexibilität!
Ein anderer Bewohner hat eine Metallplatte im Bein, die ihm nach einem Unfall eingesetzt wurde. Die Platte ist aber aus irgendeinem Grund so verwachsen, dass sie starke Schmerzen verursacht und dringend entfernt werden muss. Seit mehr als drei Monaten versuchen wir, für diesen Mann eine Operation zu organisieren. Auch hier ist die Finanzierung längst geklärt. Dennoch kommt die Operation nicht zustande, weil die Klinik und der Patient nicht zusammenkommen beziehungsweise seltsame Dinge schiefgehen:
Einmal kam der Patient mit Unterlagen in die Unterkunft zurück, die auf eine begonnene Operationsvorbereitungen schließen lassen. Aber mit der Klinik ließ sich nicht klären, warum die OP-Vorbereitung abgebrochen und der Patient nicht aufgenommen wurde, da der begleitende Landsmann nicht gut genug Englisch sprach. Er solle sich einen professionellen Dolmetscher suchen, hieß es von der Klinik.
Dann fehlte wieder einmal ein Yellow Paper – wahlweise ist es die Kostenzusicherung, die sich dann doch anfand. Als wir den inzwischen fünften Termin für die Operation vereinbarten, sagte der Bewohner zu mir, er sei nun sehr müde, und es tue ihm leid, dass ich seinetwegen so viel Arbeit hätte.
Was ich in den ersten Monaten Asylsozialberatung über die medizinische Versorgung von Flüchtlingen gelernt habe? Unser Gesundheitssystem muss sich auf Flüchtlinge einstellen, indem es flexibler wird! Die Probleme, die wir derzeit sehen, werden sich nicht lösen lassen, indem man so weitermacht wie bisher und Flüchtlinge als potenzielle Störfaktoren eingespielter, starrer Abläufe wahrnimmt. Diese Abläufe müssen hinterfragt – und vor allem müssen Ausnahmen gemacht und kreative neue Ansätze gefunden werden. Am Ende hilft das vielleicht auch allen anderen Patient_innen.
Gelb – Weiß – Grün: Das bunte Farbenspiel der Bürokratie
Manchmal scheint es, als wären Flüchtlinge nichts ohne ihr „Yellow Paper“. Aber das ist nicht ganz richtig. Flüchtlinge brauchen auch ein „White Paper“, die Registrierungsbestätigung. Davon bekommen sie ironischerweise jedoch nur den grünen Durchschlag.
Dieser ist die Grundlage dafür, dass ihnen ihre Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende – die inzwischen berühmte BüMA – ausgestellt wird. Gleich danach kommt aber das „Yellow Paper“, der Behandlungsschein für die ambulante ärztliche Versorgung. In Bayern wird dieser von der zuständigen Sozialbehörde auf gelbem Papier ausgedruckt.
Antje Sanogo arbeitet seit 1990 im Migrationsbereich. Sie war über 13 Jahre bei der Münchner Aids-Hilfe tätig, zuletzt als Leiterin des Bereichs „Beratung und Prävention“. Seit Januar 2016 arbeitet sie in der Asylsozialberatung in einer Münchner Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge.