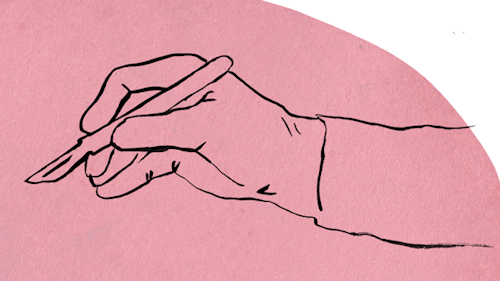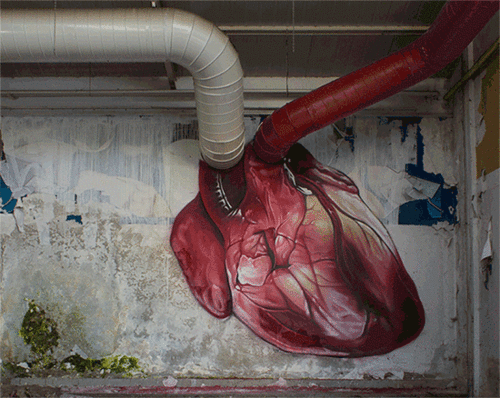Let it go
oder auch: Let it be. Je nach Altersgruppe könnt ihr euch jetzt zwischen zwei Einleitungen entscheiden. Bzw. wenn ihr gleichzeitig Disney- und Beatlesfans seid, auch für beide.
Einleitung Nummer 1: Nachdem ich großer Beatlesfan bin, so ziemlich viele alle Liedtexte auswendig kann, vor kurzem glückselig über die Pennylane spaziert bin und auch an meiner Hochzeit ein Song der Fab Four gespielt wurde, musste ich mir natürlich auch die Carpool-Karaoke-Folge mit Paul McCartney ansehen. In der er den Ursprung des Liedes “Let it be” erklärt. Seine Mutter starb als er noch ein Teenie war, und eines Tages erschien sie ihm im Traum und versicherte ihrem Sohn, dass alles gut werden würde. Sie sprach also zu ihm “Let it be”, und daraufhin schrieb er das Lied. (Ich hatte Tränen in den Augen, als er das vor der Kamera erzählte.)
Einleitung Nummer 2: Ja, ich bin erwachsen. Ja, ich bin mit Disneyfilmen aufgewachsen. Ja, sie vermitteln oft ein komisches Frauen- und Männerbild. Frozen ist zwar nicht mehr ein klassischer, alter Disneyfilm wie zum Beispiel Bambi, Dumbo oder Pocahontas, aber trotzdem ertappte ich mich dabei, dass ich letztens um 3 in der Früh schlaflos im Bett lag und mir dachte, hm, ich könnte mir doch Frozen ansehen. Die Eiskönigin singt in der zweiten Hälfte des Filmes “Let it go”. Turn away and slam the door…
Nun denn, was haben also nun die Beatles und Königin Elsa mit einem Medizinblog zu tun?
Bei uns lag vor ein paar Monaten eine alte Dame. Mit alt meine ich, sie war über 80. Ihre Diagnoseliste war länger als die Number-1-Hits-Liste der Beatles. Die war also wirklich ewig lange. Zusätzlich zu arterieller Hypertonie, Diabetes, Status post CVI, Kardiomyopathie, Dyslipidämie, Vorhofflimmern, Osteoporose, und so weiter und so fort gesellten sich noch sage und schreibe 4 verschiedene Krebsdiagnosen. Alle im Abstand von einigen Jahren diagnostiziert. Nun dachten sich einige Herrschaften, dass die Frau trotz des Alters und der mehr oder minder großen Nebenbaustellen ja doch noch ganz fit sei und man den neuen Tumor doch rausoperieren könne. Die Dame war überzeugt, ihre Angehörigen auch und so ging die Operation gut über die Bühne – oder den Tisch -, aber wie so oft scheitert es bei heiklen Operationen nicht an der Operation selbst, sondern an der Zeit danach. Hält der vorbelastete Körper die Narkose und den stundenlangen Eingriff aus? So wanderte die Patientin vom Aufwachraum auf die Intensivstation, auf die Normalstation, auf die Intensivstation und so ging das Spiel über mehrere Tage bis Wochen. Irgendwann musste sie aufgrund einer respiratorischen Dekompensation erneut intubiert werden, und so standen irgendwann viele Menschen um das Bett. Die Pflege war frustriert, manche ÄrztInnen auch, aber manche davon dachten immer noch an… ähm… ein Wunder? Oder an die Genesung… Und dann waren da noch die sehr, sehr fordernden Angehörigen. Aber vorher sei es ihr doch so gut gegangen… sie musste zwar gefühlte 100 Tabletten am Tag schlucken und war dauernd in der Hausarztpraxis, aber so wie es die Kinder schilderten lebte sie vor dem einen bösen Eingriff das Leben einer 20-Jährigen. Ich verstehe den Schmerz. Das Nicht-Loslassen wollen und können. Die Trauer, die Angst. Die Verzweiflung. Und irgendwann stand ich neben den Angehörigen und dachte mir einfach nur: Let it go. Let it be.