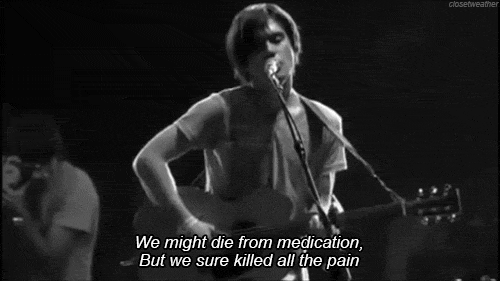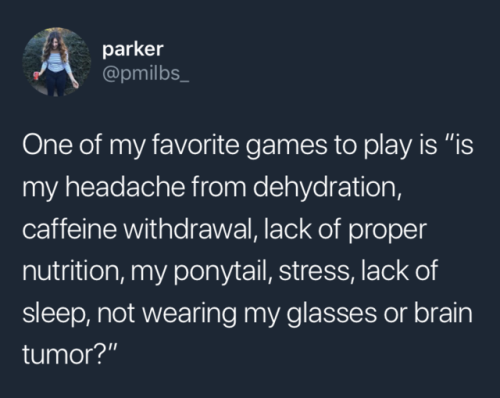Grundsätzlich soll man ja ehrlich sein. Authentisch. Empathisch. Von Anfang an, lernt man sie, die Gebote. Wie man sich zu verhalten hat und wie man mit Mitmenschen umgeht. Besonders als Ärztin, würde man sich denken, soll man sich daran halten. Und dann habe ich mich heute in flagranti dabei ertappt: beim Lügen. Wenn man es ein bisschen netter auslegt, war es nicht wirklich lügen, aber es war ganz offensichtlich eines: nicht komplett ehrlich sein.
Frau K. ist ein Dauergast bei uns. Was bedeutet, dass sie seit Monaten bei uns liegt. Die Situation wird maximal ein kleines Bisschen besser, dann gibt es wieder einen Rückschlag. Die nächste Sepsis und Revisionsoperation. Wieder neue Antibiotika. Neu eingelegte Drainagen. Katheterwechsel. Künstliche Ernährung. Maschinenbeatmung. Trotz der sehr bemühten und geduldigen PhysiotherapeutInnen und Pflegefachpersonen baut Frau K. ab, sie kann aufgrund der schweren Krankheit und den atrophierten Muskeln nicht mehr alleine laufen. Sie wird künstlich ernährt, da sie auch nicht selbstständig schlucken kann. Grund der ganzen Misere war ein missglückter Suizidversuch, der ordentlich in die Hose ging. Sie überlebte, und dann eigentlich doch nicht ganz. Sie ist nicht tot, aber ihr jetziger Zustand auch kein Leben, das man sich wünscht.
Ihre Familie ist wahnsinnig geduldig, nimmt mehrmals wöchentlich einen langen Weg auf sich. Man spürt den Zusammenhalt und die Wünsche. Jeder kleine Fortschritt nährt die Hoffnung, dass Frau K. wieder nachhause zurückkehren kann. Doch ein Fortschritt bei Frau K. bedeutet, dass sie zum Beispiel auf Ansprache die Augen öffnet. Sie kann nicht alleine schlucken, essen, sich aufsetzen, waschen oder anziehen. Die Bakterien haben Abszesse an allen erdenklichen Körperstellen gebildet und bei einem Stop der antibiotischen Dauertherapie wäre es nur eine Frage von wenigen Tagen, bis der nächste Schüttelfrost Einzug hält.
Auf der anderen Seite ist sie nicht instabil. Zu schlecht um alleine zu überleben, zu gut um zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die Maschinen abstellen und sie gehen lassen.
Dann steht ihre Schwester mit Tränen in den Augen vor mir, die den langen Leidensweg hautnah mitbekommen hat und mir die Frage nach der Prognose stellt. Ich antworte vage, dass man nichts fix voraussagen kann, aber eine lange Rehabilitation auf Frau K. wartet.
Und in Wirklichkeit sehe ich maximal einen schwersten Dauerpflegefall vor mir.